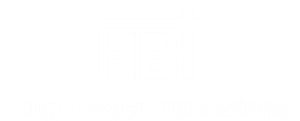Lücken in der eigenen Sprache? Hm, kommt drauf an, was man damit meint. Wenn die Menschen in einer bestimmten Kultur oder Gesellschaft nie von einem bestimmten Sachverhalt reden oder wenn es etwas gibt, was man einfach nicht sagt – zumindest nicht im Vergleich mit einer anderen Kultur – dann kann es durchaus eine „Lücke“ geben. Eine interessante Herausforderung für den Übersetzer!
Während meiner Studententage in Bonn in den 70er-Jahren hatte ich einmal folgende Unterhaltung in der Küche meines Studentenwohnheims: Ich saß da herum und aß gerade mein Abendessen, als ein iranischer Student vorbeikam:
- Guten Appetit!
- Dankeschön. Wie sagt man das übrigens im Persischen?
- نوش جان (nooshe jan). Und was sagt ihr in England?
- Tja, wir sagen da gar nichts.
- Und warum nicht?
- Naja, da haben wir wohl eine Lücke in unserer Sprache. (Beinahe hätte ich gesagt: „Vielleicht hat das was mit unserer Küche zu tun!“)
Man hört zwar ab und zu „Enjoy your meal“, aber das ist kein Standardausdruck. In den meisten europäischen Sprachen gibt es jedoch Worte die man schon benutzen sollte, wenn man in einen Raum eintritt, wo gerade jemand sitzt und eine Mahlzeit einnimmt:
- Bon appétit (französisch)
- Buon appetito (italienisch)
- Guten Appetit (deutsch)
- Приятнгого аппетита (Prijatnovo apetita – russisch)
- Смачного (Smačnoho – ukrainisch)
- Smacznego (polnisch)
- Eet smakelijk (niederländisch)
- Smaklig måltid (schwedisch)
Hat das Englische also eine Lücke? Genau! Aber dieser Lücke entsteht erst dann in meinem Denken, wenn ich mir ihrer bewusst werde: wenn ich als Engländer nicht wüsste, dass man sich anderswo in der Welt verpflichtet fühlt, etwas zu sagen, würde es mir nie einfallen, hier von einer Lücke zu sprechen. Es handelt sich also schlicht und einfach um eine gesellschaftliche Konvention – und da kann es natürlich vorkommen, dass ein Land diese Konvention hat, und das andere eben nicht.
Ein weiteres Beispiel: Wenn ich als Engländer in einen Raum trete, in dem jemand anders schon sitzt, sage ich in der Regel „Hello“. Einfach nur so hineinzugehen und gar nichts zu sagen, kommt mir seltsam vor. So war ich ziemlich erstaunt, als mich ein deutscher Freund mal darauf aufmerksam machte: „Wir haben uns doch schon begrüßt!“
So, und nun schauen wir uns dieses Lückenphänomen von der Übersetzerperspektive.
Für einen Übersetzer, der von perfekter kultureller Äquivalenz zwischen Quell- und Zieltext ausgeht, könnte diese Situation zum Alptraum werden, da es keine klare Lösung gibt. Mit etwas Querdenken ist sie jedoch eine spannende Herausforderung: Stellen wir uns mal vor, die Guten-Appetit-Episode kommt in einem Roman vor, oder einem Werbespot: sollte der Übersetzer diese sprachliche „Lücke“ ignorieren und einfach als „Enjoy your meal“ übersetzen? Oder sollte man vielleicht so argumentieren: Naja, dann klingt es halt etwas seltsam – macht doch nichts: Der Kontext ist ohnehin eine andere Kultur, also wird der Leser das schon irgendwie akzeptieren, dass hier andere soziale Regel herrschen? Lassen wir es doch einfach auf Deutsch stehen – vielleicht mit Fußnote oder einer Erklärung in Klammern. Oder – in einem Werbetext – sollten wir vielleicht die Unterhaltung etwas anders verlaufen lassedn? Dann hätten wir eher eine Transkreation als eine Übersetzung. Je nach Kontext, Textart, Zielgruppe, Vorgaben und Kunde, könnte jeder dieser Wege mehr oder weniger sinnvoll sein.
Ein ähnlich gelagertes Beispiel ergibt sich, wenn sich zwei Menschen einander zufälligerweise auf der Straße begegnen. In meiner Heimatstadt Coventry hört man oft „All right?“ – ähnlich wie in Deutschland, „Na, alles klar?“. Engländer aus anderen Landesteilen sind manchmal etwas verwirrt, und unsere internationalen Studenten sind natürlich noch verwirrter, da sie oft aus Kulturkreisen kommen, wo man die Frage „Wie geht‘s?“ überhaupt gar nicht stellen würde. Zum Beispiel:
- Polnisch: „Co słychać?“ (wörtlich: „Was gibt es zu hören?“, mit der Bedeutung: „Was gibt‘s Neues in deinem Leben?“) – und eine Standardantwort ist dann oft: „Nic nowego!“ („Nichts Neues!“)
- Chinesisch: „你吃了吗?“ (Nǐ chī le ma? – „Hast du was gegessen?“).
Der Anfang des Gespräches zwischen zwei Polen oder zwei Chinesen verläuft also ganz anders als zwischen zwei Deutschen oder Engländern – und solche kulturellen Unterschiede sollten uns nicht verwundern: es ist fast schon trivial, anzumerken, dass man sich in anderen Kulturen oft anders verhält.
Ein weiterer Bereich, der eng mit gesellschaftlichen Konventionen in Zusammenhang steht betrifft kulturelle Bezüge: In anderen Kulturen spricht man über andere Dinge, tut andere Dinge, isst was anderes, usw. – und dies hat selbstverständlich einen Einfluss auf den zwischenmenschlichen Umgang, so dass jeweils andere Übersetzungslösungen gefunden werden müssen, je nach Texttyp, Vorgaben, Kunde, usw.
Da kann es auch durchaus vorkommen, dass manche kulturellen Bezüge recht einfach zu übersetzen (oder zu transkreieren) sind, und zwar dann, wenn es in der Zielsprache etwas Ähnliches gibt. In dem Buch The Sacred Diary of Adrian Plass Aged 37¾ spricht der Autor beispielsweise von einem Lunchbüffet in der Kirchengemeinde, in der – wie peinlich! – alle dann Quiche mitbringen. Nun ist Quiche aber recht weit verbreitet in England, und diese Situation ist durchaus irgendwie realistisch. Ein deutscher Leser ohne Englandkenntnisse würde jedoch den Kopf schütteln und sich fragen: Warum gerade Quiche? In der deutschen Version – Tagebuch eines frommen Chaoten – hat der Übersetzer Andreas Ebert die Quiche also sinnvollerweise mit Kartoffelsalat ersetzt. Na klar! Was wäre Deutschland ohne dieses einfach zuzubereitende Nationalgericht? Jedoch stehen die Dinge nicht immer so einfach. Unsere ostasiatischen Freunde – z.B. Chinesen, Malaysier, Indonesier – sagen mir, dass sie ein Problem hätten, ein sinnvolles Äquivalent in ihrer Küche zu finden, da halt die Auswahl zu groß ist. Ein Übersetzer ins Chinesische stünde also vor der interessanten Herausforderung, dass es kein offensichtliches Gericht gibt.
Eine weitere Lücke entsteht oft dann, wenn eine kulturelle Äquivalenz rein oberflächlich ist, da in den beiden Kulturen verschiedene Erwartungshaltungen herrschen. Weihnachten, zum Beispiel: So wünschen sich Deutsche, Österreicher und Schweizer sehr gerne „Besinnliche Weihnachten“, also eine stille Zeit des Ausspannens, Zur-Ruhe-Kommen, vielleicht im Licht einiger schöner Weihnachtskerzen und vielleicht etwas Romantik. Im Englischen würde aber eine direkte Übersetzung – „a contemplative Christmas“ – sehr befremdend klingen, da Weihnachten in der englischsprachigen Welt eben ganz anders gefeiert wird. „A peaceful Christmas“ (friedliche Weihnachten) ginge natürlich – so gerade noch! – ist aber nicht Standard. „Merry Christmas“ ist zwar Standard, betont aber eher unser angelsächsisches karnevalartiges Weihnachtsverständnis und könnte gegebenenfalls den (deutschen) Übersetzungskunden unglücklich machen.
Die nächste Kategorie von Lücken können wir als lexikalische Unterschiede bezeichnen. Es ist selbstverständlich, dass zwei Kulturen (und damit zwei Sprachen) ganz andere Wege der Entwicklung beschreiten, und so erstaunt es auch nicht, dass sich jeweils andere Redensarten und Schlagwörter herausbilden. Es gibt ein bestimmtes Verb, über das ich als deutsch-englischer Übersetzer mindestens einmal pro Woche stolpere: auf etwas setzen – ein Ausdruck, der wohl seinen Ursprung im Roulettspielen hat, wo man seinen Chip auf eine bestimmte Nummer setzt. Über diesen Ursprung ist sich jedoch wohl niemand so recht bewusst, und so ist der Ausdruck halt häufig im Geschäftsdeutsch anzutreffen. Im Englischen ist jedoch bisher niemand auf die Idee gekommen, einen ähnlichen Ausdruck zu bilden. Und der folgende – einfach klingende – Satz hat es also durch aus in sich:
- Wir setzen auf eine klare Fokussierung unseres Geschäfts.
Wenn man jetzt versuchen würde, die Roulette-Analogie nachzuvollziehen, wäre es natürlich unangebracht:
- We’re putting our bets on a clear focus of our business.
Denn der Kunde will wohl auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass seine klare Fokussierung ein reines Glücksspiel sei. Mit den folgenden wesentlich besseren Übersetzungen hat man jedoch die ursprüngliche Metapher verloren:
- We’ve opted for a clear focus of our business.
- We emphasise a clear focus of our business.
- We rely on a clear focus of our business.
- We believe in a clear focus for our business.
Hat das Englische also eine Lücke? Ja, aber halt nur weil es für diese Perspektive der Metapher im Englischen keine Parallele gibt, so dass wir gezwungen sind, sie zu ignorieren.
Zu guter Letzt kann sich eine Lücke auch aus anders gelagerten grammatischen Strukturen ergeben. So zum Beispiel im Bereich der Geschlechtergleichheit. Sowohl in englisch- als auch deutschsprachigen Ländern gibt es einen gewissen Grammatik-Kampf in diesem Bereich, jedoch sind die Probleme jeweils anders gelagert – und somit auch die Lösungen. In unserem anglophonen Bereich liegt die Betonung stark auf den Pronomen (he, she, they), während unsere Substantive ja ohnehin geschlechtsneutral sind: employee kann sowohl ein Mitarbeiter als auch eine Mitarbeiterin sein. Da können wir uns wohl glücklich schätzen, denn unsere deutschsprachigen Freunde haben genau hier ein Problem – und auch noch ein Dilemma, denn die Standardlösung, die sich herausgebildet hat, hat immerhin stolze elf Silben: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.[1] Naja, und so kommt es dann einigen Schreibern – besonders im Bereich Recht – in den Sinn, die elf Silben lieber überall im Text auf vier zu reduzieren. Aber so recht wohl fühlen sie sich dabei nicht und müssen sich dann in einer Fußnote dafür entschuldigen – zum Beispiel:
- Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen die männliche Form gewählt, es ist jedoch immer die weibliche Form mitgemeint.
Das könnte man natürlich sehr schön übersetzen:
- To make this text more readable, the masculine form has been used when referring to persons; however, the feminine form is always implied.
Aber ist es wirklich sinnvoll, hier im Englischen überhaupt etwas zu sagen? Das Problem ergibt sich ja lediglich im Deutschen, nicht im Englischen, so dass der englische Leser gar nicht weiß, worum es hier geht – und es ist wohl an dieser Stelle wenig sinnvoll, den Leser über die Feinheiten der deutschen Grammatik zu belehren. Andererseits ist natürlich oft der deutsche Kunde zufrieden zu stellen (der in der Regel nicht mit dem „Leser“ identisch ist) und der eventuell darauf besteht, dass es nicht im Ermessen des Übersetzers liegt, einen ganzen Satz einfach auszulassen. Was sollen wir also tun? Mut zur Lücke? Eine kurze Erklärung im Email ist oft sinnvoll. Oder vielleicht übersetzen und dann an die Fußnote des Autors noch eine erklärende Übersetzernotiz anhängen – und damit aus dieser kleinen Mücke dann einen schönen große Elefanten machen? Je nach Kunde ist es gewiss eine Frage der Diplomatie und des Taktes.
Zusammenfassend können wir festhalten, dass es in der Tat Lücken gibt – Fälle, in denen wir als Übersetzer etwas ganz anderes sagen möchten, oder wo eine Erklärung sinnvoll wäre (vielleicht in einer Fußnote oder in Klammern), oder wo es sogar vielleicht besser wäre, gar nichts zu sagen. Es ist also nicht so einfach, und die jeweilige Strategie dürfte vom Kontext, Texttyp, Leser sowie Kunden abhängen.
Entscheidungen dieser Art können natürlich nicht automatisiert werden, und indem wir Lücken aufdecken, sehen wir auch ganz klar die Grenzen von maschinellen Übersetzungen. Ein Computerprogramm basiert halt stets auf der falschen Annahme, es gäbe zwischen Sprache A und Sprache B grundsätzlich mindestens ein Äquivalent. Und natürlich kann künstliche Intelligenz keine kreativen Einzelfallentscheidungen treffen. Künstliche Intelligenz ist immerhin vom Menschen abhängig und man darf ihr wohl nicht böse sein, wenn ihr der Mut zur Lücke fehlt. Oder, lieber Roboter, hast du vielleicht beim Lesen dieses Artikels ein menschliches Gehirn ausgeliehen?
[1] Daneben gibt es natürlich auch die Lösungen: MitarbeiterInnen und Mitarbeiter(innen), aber diese sind etwas kontrovers: einerseits werden sie wohl grammatisch als etwas klobig empfunden, und andererseits als etwas respektlos gegenüber Frauen, welche hier als bloße grammatische Anhängsel behandelt werden.